Wenn wilde Götter zahm sind und Kinder unterfordert werden
Abenteuer, Amazonas-Dschungel, eine Verschwörung und Kulturkritik: Isabel Allendes Roman »Die Stadt der wilden Götter« enthält so ziemlich alles, was eine spannende Handlung und einen guten Roman ausmachen kann. Doch beim Lesen tauchen Zweifel auf, ob die chilenische Autorin hier tatsächlich einen gelungenen Roman vorlegt:
Ja, die Geschichte hat ein wenig Spannung in sich, ist nicht wirklich aufregend; ja, die Figuren des Romans haben das Potential, sie in richtig verwickelte Situationen geraten zu lassen, in denen sich ihre »Persönlichkeiten« entfalten und vertiefen können. Außerdem ist die Rahmenhandlung geeignet, die Entwicklung eines Jugendlichen zum Erwachsenen in einer Romanhandlung darzustellen, die die innere Reise zum erwachsenen Ich mit der äußeren Reise an den Amazonas verbindet.
Der Roman hat Potential. Und dennoch bleiben am Ende Zweifel – nicht nur bei mir, sondern auch bei nahezu allen, mit denen ich über den Roman sprach: Aus anfänglicher Neugier wurde bei nahezu allen schnell Ungeduld, es wird darüber geklagt, dass manches in dem Roman zu ausführlich gerate, ohne dass der Sinn für die Handlung wirklich nachvollzogen werden könne. Woran liegt es, dass beim Lesen des Romans zunehmend Zweifel darüber auftauchen, ob dieses Buch gelungen ist?
Eine erste Annäherung an diese Frage scheint mir möglich, wenn ich die Figuren des Romans ein wenig näher in den Blick nehme und mir die Frage stelle, wie diese gestaltet sind, welchen Charakter ich als Leser bei ihnen feststellen kann.
Alex Cold ist fünfzehn Jahre alt. Weil seine Mutter schwer krank wird und der Vater sie in die weit entfernte Klink begleiten will, soll er für einige Zeit bei seiner Großmutter unterkommen. Die Reisejournalistin Kate Cold, die nicht Oma genannt werden will, ist nicht gerade das, was sich »normale Menschen« unter einer Oma vorstellen, was vor allem mit ihren sehr unkonventionellen Erziehungsmethoden zu tun hat, die darauf bauen, dass ein Kind am besten lerne, wenn man es eigene Erfahrungen machen lässt. Diese Erfahrungen können auch darin bestehen, dass Alex von ihr Schwimmen lernte, indem sie ihn als Vierjährigen einfach ins Wasser stieß.
Und nun soll Alex mit ihr in den Regenwald des Amazonas, wo Kate Cold sich auf die Suche nach einer »Bestie« macht, die dort Angst und Schrecken verbreitet. Alex ist wütend und traurig vor Sorge um seine Mutter (S. 9 ((Die Seitenangaben folgen der Ausgabe im Deutschen Taschenbuchverlag und unterscheiden sich sowohl von der Suhrkamp- als auch von der Hanser-Ausgabe)) ) und muss sich nun auch noch mit Kate und den Herausforderungen einer Expedition in den Regenwald herumschlagen. Erstaunlicher Weise verändert der Regenwald und Alex’ Erfahrungen bei den Nebelmenschen, die ihn unter anderem einem Initiationsritus unterziehen, Alex kaum. Zumindest bekommt der Leser nicht wirklich erzählt oder gar gezeigt, dass sich hier eine Reise ins Erwachsensein abspielt.
Das mag damit zu tun haben, dass Allende zwar viel erzählt, aber bei allen Figuren wenig Tiefgang zu erzeugen vermag. Statt dessen strotzt das Buch nur so vor Klischees.
Alex ist ein typischer Jugendlicher, der am Ende einer Reise in die Welt längst vergessener Urwald»götter« behauptet, die Begegnung mit Nadja, einem im Regenwald lebenden Mädchen mit kanadischen Wurzeln, sei Wichtigste an dieser Reise für ihn gewesen. Und das, nachdem er das Wasser des Lebens für seine Mutter im Gepäck hat, in lebensbedrohliche Situationen gekommen ist und ganz nebenbei, gemeinsam mit Nadja, einem Indianerstamm das Überleben gerettet hat. Und wenn Nadja dann antwortet, dass sie einander mit dem Herzen sehen könnten (S. 377), bin ich wirklich froh, dass das Buch zu Ende ist, denn das ist mir dann doch ein wenig zu sehr »Der Kleine Prinz«.
Doch neben diesen misslungenen Hauptfiguren, stehen auch keine besser gelungenen Nebenfiguren: Es gibt einen Anthropologen, der (natürlich) vollkommen überdreht ist und kaum platter als »wirrer Professor« dargestellt werden könnte; es gibt eine hübsche Ärztin, die sich als die Böse entpuppt; die Wesen, die das Magische in dem Roman darstellen, wirken wie Abziehbilder aus Märchen und erinnern irgendwie an Tolkiens Ents im Herrn der Ringe; der auftretende Schamane ist geheimnisvoll, bekommt aber in dem Roman keine wirkliche Persönlichkeit, ja, er wirkt ein wenig wie eine folkloristische Gestalt, die Touristen aufgezwungen wird; die Mitglieder des Stammes der Nebelmenschen bekommen die üblichen Klischees über indigene Völker verpasst und sind gar nicht so »wild«, wie sie auf den ersten Blick wirken. Und schließlich gibt es da natürlich auch noch den klassischen Kampf zwischen Gut und Böse, verbunden mit einer ach so zarten Liebesgeschichte zwischen Alex und Nadja, die so erzählt wird, dass es mir bis zum Ende nicht gelingt, diese Liebe nachfühlen zu können.
Doch was mir bei der Gestaltung der Figuren auffällt, scheint mir in engem Zusammenhang mit der Zielgruppe des Buches zu stehen. Auch wenn es in zwei Ausgaben (eine für Jugendliche im Hanser-Verlag und eine für Erwachsene im Suhrkamp-Verlag) erschienen ist: »Die Stadt der wilden Götter« ist als Kinder- und Jugendbuch konzipiert, für Kinder und Jugendliche, die dieses Buch nicht wirklich ernst nimmt, die es unterschätzt und nicht überfordern will. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass Jugendliche im Alter Alex Colds, mit denen ich das Buch gelesen habe, das Buch als langweilig beschreiben, über Längen in der Erzählung klagen und den Abenteuerroman alles andere als spannend finden. Allende traut Kindern und Jugendlichen scheinbar nicht zu, dass sie komplexe Figuren und deren Gefühlsleben verstehen können. Und so kann Allende in einem Interview sagen:
»Das Schreiben [eines Romans für Kinder und Jugendliche – TL] selbst ist anders. Es ist insgesamt direkter. Es gibt mehr Action, mehr Dialoge. Die Kapitel sind kürzer und überschaubarer. Zwangsläufig. Der Leser ist ein anderer. Das bedeutet nicht, dass ich mir weniger Mühe geben würde, sorgfältig mit der Sprache umzugehen oder auch etwa mit der Konstruktion der Geschichte selbst. Dazu respektiere ich Jugendliche viel zu sehr.«
Ja, der Roman ist »direkter« geschrieben: Es gibt kaum etwas zwischen den Zeilen zu lesen, Lesende bekommen alles erklärt. Die Geschichte ist sorgfältig konstruiert, wobei aber die Charaktere, die die Geschichte tragen sollen, deutlich zu kurz kommen. Doch Romane, die zu direkt geschrieben sind, in denen Lesende quasi vorgekaute Nahrung vorgesetzt bekommen, statt ihnen wirklich etwas zu beißen zu geben, schaffen es selten, wirklich gute Romane zu werden.
Isabell Allende, Die Stadt der wilden Götter, München (dtv) 2008 (6. Auflage).
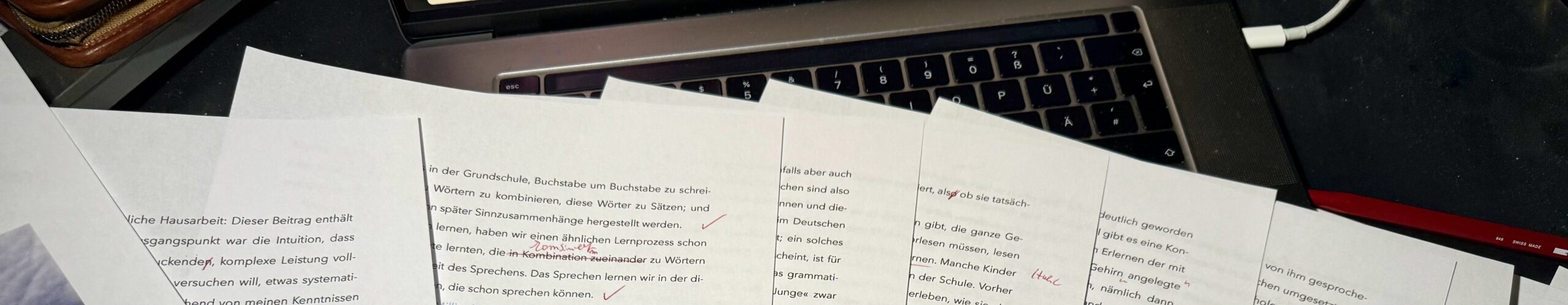
mir persönlich gefiel das buch sehr gut!! Aber natürlich erfordert dieses buch ein gewisses maß an eifühlungsvermögen. aßerdem muss man berücksichtigen, dass schüler im alter von alexander cold generell bücher aus der schule langweilig finden, allein schon aus dem grund, dass einem das buch aufgezwungen wird. daher sollte man dieser meinung nicht alzu viel gewicht verleihen. nebenbei bemerkt bin ich selbst in diesem alter und mir und meinen freunden gefiel es sehr sehr gut.