Mischwald und Monokultur: Offene Unterrichtsformen und direkte Instruktion
Als erste These formuliert Hilbert Meyer in „Was ist guter Unterricht“ ((Hilbert Meyer, Was ist guter Unterricht, Berlin (Cornelsen Scriptor) 2004, S. 9.)) die Aussage, dass Mischwald besser als Monokultur sei.
Meyer bezieht sich mit dieser These auf die Frage, ob Unterricht eher lehrerzentriert, also durch direkte Instruktion, oder eher offen, stark von den Lernenden selbst reguliert, erfolgreich sein könne. Dabei kommt er zu dem Schluss, dass empirische Daten bis heute keine Überlegenheit eines dieser Konzepte belegen können.
Das ist vor allem deshalb erstaunlich, weil in der Ausbildung scheinbar sehr stark auf die Eigenaktivität der Lernenden gelegt wird. Scheinbar? Denke ich an die genauen Formulierungen zurück, die ich in der Ausbildung während des Referendariates zu hören bekam, so hieß es dort immer, dass es vor allem darum gehe, dass bei den Lernenden kognitive Prozesse nachvollziehbar sichtbar werden. Nachvollziehbare kognitive Prozesse sind aber solche, die keines der beiden scheinbar im Widerstreit liegenden Konzepte von eher offenem und eher direkt instruierenden Unterrichtens bevorzugen, sondern ganz klar schülerorientiert sind: Wird im Unterricht ein Prozess des Nachdenkens, der kognitiven Leistung der Lernenden sichtbar?
Der Vorteil eher offenen Unterrichts ist im Rahmen einer solchen Erwartung scheinbar, dass eine starke Eigentätigkeit von Lernenden relativ leicht erzeugt werden kann.
Doch „Eigentätigkeit“ bedeutet nicht, dass diese auch mit nachvollziebahren kognitiven Prozessen, die auf ein nachhaltiges Lernen hin ausgerichtet sind, sichtbar werden. „Eigentätigkeit“ kann auch sehr mechanisch ablaufen, Arbeitsaufträge können auch erfüllt werden, ohne dass dies mit „kognitiven Prozessen“ nachhaltiger Art verbunden sein muss.
Meyer kommt daher zu dem Schluss, das Mischwald in diesem Zusammenhang besser als Monokultur sei, dass also ein Gleichgewicht zwischen direkter Instruktion und offenem Unterricht möglicherweise zu den nachhaltigsten Lernerfolgen führen könnte.
Das heißt aber auch, dass Lehrende, bei allen persönlichen Vorlieben, was den Einsatz von Methoden angeht, einen Ausgleich zwischen direkter Instruktion und offenem Unterricht finden müssen.
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an eigene Erfahrungen in der Schule und ganz besonders im Studium. Immer wieder erlebte ich Professoren, deren Seminare vor allem aus von den Professoren weitgehend unkommentierten Referaten bestanden.
Ich empfand dies immer als unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, dass die entsprechenden Professoren uns gegenüber die Weitergabe ihres Wissens verweigerten.
Andere Professoren hingegen waren von ihrer Materie so begeistert, dass sie ausschließlich dieses vortrugen, was ich als ebenso unbefriedigend empfand, weil sie uns als Seminarteilnehmer nach meinem Eindruck aus dem aktiven Denkprozess rund um Thema ausschlossen und den Eindruck erweckten, sie wüssten alles und angesichts dieser Allwissenheit sei unser eigenes Nachdenken eher überflüssig, da wir es durch Erlernen der vorgestellten Konzepte ersetzen könnten.
Spannend fand ich die Professoren, die Forschungsergebnisse zur Diskussion stellten, uns mit ihnen zum Nachdenken auch zum Widerspruch bringen wollten, indem sie einerseits Forschungsergebnisse anschaulich und authentisch vorstellten, dann aber Prozesse in Seminaren initiierten, die darauf aus waren, dass wir uns reflexiv mit dem vorgestellten Wissen beschäftigten und gegebenenfalls auch zu anderen Ergebnissen kommen.
Unterricht ist weder eine Monokultur noch eine Einbahnstraße von einem Wissenden zu Unwissenden hin. Zumindest in den geisteswissenschaftlichen Fächern gilt dies. Vielmehr geht es darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem sowohl die Aneignung von Wissen, in deren Rahmen Lehrende durchaus sowohl all das zeigen sollten, was sie von Lernenden z. B. im Rahmen von „Referaten“ erwarten, als auch die eigene Reflexion von Wissen ihren Raum finden lassen, sodass es durchaus passieren kann, dass Lehrende angesichts der Reflexionsprozesse in einer Lerngruppe selbst zu neuen Erkenntnissen kommen können und im Rahmen des Unterrichtens auch zu Lernenden werden können, die die Denkprozesse der Schüler und Schülerinnen so ernst nehmen, dass diese gegebenenfalls auch die bisherige Position des Lehrers verändern oder vertiefen können.
Einen „Mischwald“ der Unterrichtskonzepte und der Methoden verspricht letztlich am ehesten „guten Unterricht“, nicht zuletzt, weil ein solcher „Mischwald“ bereits differenzierend wirkt und so unterschiedliche Lerntypen in Lerngruppen anzusprechen vermag.
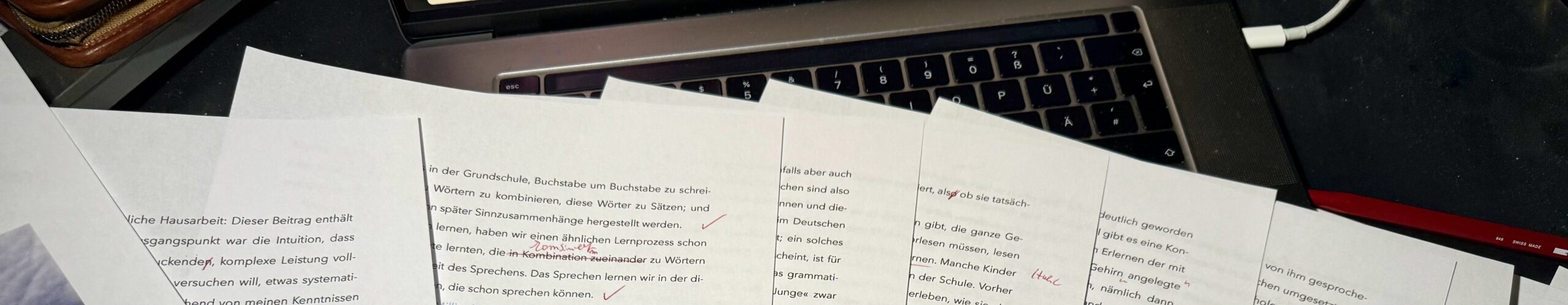
Mischwald war schon immer gesünder als Monokultur. Das ist allerdings auch eine Typfrage, dem einen liegt eher frontal, dem anderen Selbstlernprozesse zu initiieren. Die entscheidende Kunst ist, über den eigenen Schatten springen zu können und beides anzubieten.
Erinnert mich sehr an einen Beitrag aus dem Sammelband „Lebendiges Lehren und Lernen. TZI macht Schule“ von Ruth Cohn und Christina Terfurth. Auch dort wird Wert auf eine Balance zwischen Lehrer- und Lernerzentrierung (und einiger anderer Aspekte) gelegt.