Anonym: Dû bist mîn
Sechs Zeilen, die irgendwann von irgendjemanden geschrieben wurden. Überliefert wurde dieses Gedicht am Schluss eines Briefes, der auf Latein geschrieben ist. Dieser Brief wurde in der sog. Tegernseer Briefsammlung überliefert. – Mehr ist mit Gewissheit nicht über das Gedicht zu sagen, auch wenn es reichlich Fundstellen im Internet gibt, die die Vermutung, er könnte von einer Nonne geschrieben sein, als Tatsache hinstellen. Ebenso umstritten ist, ob es sich um reale Briefe oder um Musterbriefe handelt. Für die Literaturgeschichte sind solche Fragen zwar durchaus wichtig und, um ehrlich zu sein, ich finde diese Fragen auch durchaus spannend, doch für dieses Gedicht, dass als eines der berühmtesten deutschsprachigen Liebesgedichte gehandelt wird, sind diese Fragen und deren Beantwortung nicht wichtig. Viel wichtiger ist: Dieses Gedicht wirkt! Lasse ich es also zunächst einmal wirken, um es mir dann ein wenig genauer anzuschauen:
Dû bist mîn, ich bin dîn.
des solt dû gewis sîn.
dû bist beslozzen
in mînem herzen,
verlorn ist das sluzzelîn:
dû muost ouch immêr darinne sîn.(Übersetzung:
Du bist mein, ich bin dein,
dessen sollst du gewiss sein.
Du bist beschlossen
in meinem Herzen,v
verloren ist das Schlüsselein:
du musst auch immer darinnen sein.)
Auf den ersten Blick scheint mir das Gedicht sehr eindeutig: Ein Liebesgedicht, das in perfekter formaler Gestaltung daher kommt. Drei Mal zwei Vers, von diesen sind die beiden mittleren, was in vielen Wiedergaben des Gedichtes unterschlagen wird, eingerückt. Optisch wird der Inhalt dieser beiden Zeilen formal reproduziert: Eingeschlossen im Herzen des Gedichtes – und die Schlüssel sind ein für alle Mal verloren, sowohl im Gedicht, aber auch wenn es um all die Fragen geht, die sich mit der Herkunft und der Entstehung des Gedichtes befassen. Doch der Einschluss geht noch weiter: Eingerahmt sind die beiden Mittelzeilen von je zwei Versen, die mit der gleichen Reimsilbe »în« enden. Lasse ich die Mittelzeilen weg, so ergibt das Gedicht nach wie vor einen Sinn, wenn auch einen weit weniger romantischen, als die verbreiteten Lesegewohnheiten gegenüber diesem Gedicht vermuten lassen.
Als ich dieser Tage eine spontane Äußerung zu dem Gedicht zu hören bekam, die den Text zunächst einmal als etwas bedrohliches wahrgenommen hat, habe ich diese Wahrnehmung zunächst recht spontan zurück gewiesen: Hier geht es doch eindeutig um einen Menschen, der liebt und diese Liebe zum Ausdruck bringen will. – Mittlerweile bin ich mir aber nicht mehr so sicher, dass diese scheinbar eindeutige Lesart die einzig mögliche Lesart dieses Gedichtes ist. Die Gründe für diese Zweifel liegen im Text selbst:
Je länger ich mich mit dem Gedicht befasse, um so irritierender finde ich die erste Zeile. In dieser Zeile geht es um eine Art Besitzverhältnis des lyrischen Ichs und dem angesprochenen Du. Nachdem ich lange nicht so genau wusste, was mich hier eigentlich stört, merkte ich, dass es die Reihenfolge ist, in der der gegenseitige Besitz beschrieben wird. Wenn es sich eindeutig um ein Gedicht handeln würde, in dem ein Menschen einem anderen Menschen seine Liebe gestehen will, nicht mit einer Zuordnung des lyrischen Ichs zum Du beginnen? Dann aber müsste die erste Ziele »Ich bin dîn, du bist mîn« lauten, gibt sich Liebe doch zunächst einmal selbst dem Anderen hin, ohne diesen in Besitz zu nehmen.
Hier aber ist des genau umgekehrt: »Du bist mîn« lautet die erste Hälfte des ersten Verses. Das ist nicht die Hingabe eines oder einer Liebenden an ein geliebtes Gegenüber, die, wird sie erst einmal öffentlich bekannt, auch verletzlich macht, da die Liebe ja immerhin zurückgewiesen oder nicht erwidert werden könnte. Doch genau diese Verletzlichkeit, die eine solche Liebe prägt, ist in diesem Gedicht nicht zu finden. Ganz im Gegenteil: Ich höre in diesem Gedicht einen Triumph, ein Besitzen, dass ein Einschließen ist, ein Verschließen, ohne dem Gegenüber die Freiheit zu lassen. Dem Gegenüber wird dieser Tatbestand mit Hilfe einer Verkleinerungsform nahe gebracht, wenn von einem »Schlüsselein« gesprochen wird. Spätestens an dieser Stelle in Zeile 5, gefolgt von dem »musst« (von mir aus kann dies auch als »wirst« gelesen werden), verliert diese Liebe eines der zentralen Momente einer authentischen Liebe, nämlich den Respekt vor der Freiheit des anderen, der sich in Freiheit bindet und von daher bereit ist, einen Teil seiner »Freiheit« freiwillig aufzugeben. Freiheit heißt aber, im Herzen des anderen zu sein, ohne dass dieser ein Schloss braucht, um diese Liebe zu halten.
Und plötzlich klingt das »Du bist mîn« der ersten Zeile ein wenig wie eine Inbesitznahme des Gegenübers, auch wenn dann die Aussage folgt, dass das lyrische Ich auch dem Du gehöre. Doch das Du wird hier als passiv dargestellt, als wehrlos, wie Alois Weimer in seiner Interpreation des Gedichtes in »Cicero – Magazin für politische Kultur« bereits dargestellt hat, die mir bei meinem Brüten über der Frage, was mich an diesem Gedicht zunehmend stört, begegnet ist. Nein, das lyrische Ich in diesem Gedicht gibt sich nicht bedingungslos hin, sondern es vereinnahmt das Du.
Und genau deshalb, so meine These, wirkt das Gedicht so anziehend: Hier wird keine romantische Liebe beschworen! Dieses Gedicht beschreibt vielmehr, wie janusköpfig Liebe erfahren werden kann: Neben der engen Verbindung zweier Individuen – und es ist erstaunlich, dass bereits hier so etwas wie Individuen aufzutauchen scheinen, wird die Entdeckung des »Ich« doch allgemein der italienischen Renaissance zugesprochen – wird hier die Inbesitznahme des Du durch das lyrische Ich thematisiert. Liebe wird hier nicht verklärt, sondern mit ihren Gefahren dargestellt.
Diese Aussage, verbunden mit der perfekten Verbindung des Inhalts mit der Form, macht dieses Gedicht zu einem großartigen Gedicht. Ja, der romantische Teil der Liebe, wie wir sie seit der Romantik in unsere Vorstellungswelt als Ideal aufgenommen haben, klingt hier schon mit, doch er wird ergänzt durch die wenig romantische Realität der Abhängigkeit auf Gedeih und Verderb, die im 12. Jahrhundert noch Realität war, aber auch von dem Phänomen des durchaus auch materiell zu verstehenden Besitzanspruch des lyrischen Ichs gegenüber dem Du dieses Gedichtes.
Diese Doppelbödigkeit der Liebe ist bis heute nicht aus dem Erfahrungsschatz der Menschen verschwunden. Hier, in einem der ältesten Zeugnisse eines Liebesgedichtes in deutscher Sprache, die wir haben, wird dieses Phänomen bereits auf den Punkt gebracht, sodass es bis heute kein übermäßiges Problem zu sein scheint, einen Zugang zu diesem Gedicht zu bekommen, auch wenn dieser Zugang meist nur die eine, die romantische Seite der hier beschriebenen Liebe zu sehen bereit ist und dabei die weit nüchternere und deshalb auch erschreckendere Lesart dieses Gedichtes aus dem (bewussten) Blick verliert.
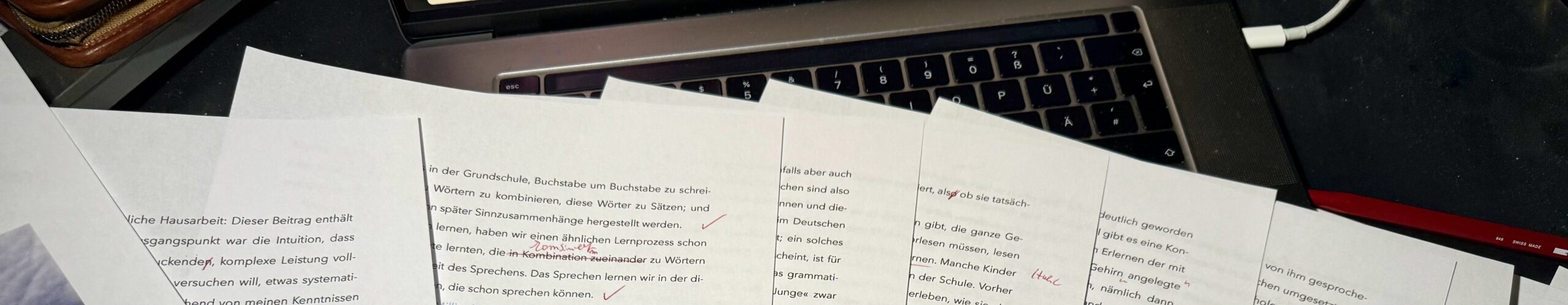
Nietsche, Die fröhliche Wissenschaft,§14: „Was Alles Liebe genannt wird“ (unter gutenberg.spiegel.de nachzulesen): der im obigen Artikel herausgearbeitete Blick auf die Liebe wird von Nietsche in seiner sprachlich genialen Art sauber analysiert. Das sollten Sie unbedingt in diesen Zusammenhang bringen.
Ansonsten, danke Herr Larbig für die interessante Seite (bin durch das „googeln“ nach der Gretchenfrage hier gelandet). Viele nette Artikel.
Schöne Grüße, Arnold
Genau diese Übersetzung hab ich für meine Hausaufgabe gebraucht! (:
Ich stimme der Deutung von Hr Larbig ausdrücklich nicht zu. Sein sprachlicher Befund ist richtig, die Ausdeutung aber beruht erkennbar auf subjektiven (modernen) Vorurteilen, ggf. eigenen Bindungsängsten, die sich am Gedichttext in keiner Weise belegen lassen – und die Gesamtaussage des Gedichts in erschreckender verzerren.
Die besitzanzeigende Aussage des lyrischen Ichs gegenüber dem angesprochenen „Du“ im ersten Teil des Anfangsverses „Dû bist mîn, ich bin dîn“ kann in keiner Weise so gedeutet werden, dass hier angeblich
a) „die Inbesitznahme des Du durch das lyrische Ich thematisiert“ und
b) „die Liebe mit ihren Gefahren dargestellt“ werde.
Zunächst handelt es sich in Vers 1 schlicht um den WECHSELSEITIGEN, das Gegenüber ganz offenbar einvernehmlich inkooperierenden Besitzausdruck, nicht Besitzanspruch (!), der – auch formal durch den sog. „Chiasmus“ unterstützt – die GEGENSEITIGKEIT der Unzertrennlichkeit und tiefe Bindung (modern: Liebes-Symbiose) zwischen beiden, lyrischem Ich und angesprochenem „Du“, prägnant zum Ausdruck bringt.
Zweitens: Die richtige Beobachtung, dass das lyrische Ich in der prononzierten Thema-Anfangsversstellung zunächst die besitzhafte Zugehörigkeit des angesprochenen „Du“ zum lyrischen Ich formuliert („Dû bist mîn“) und erst danach die eigene Zugehörigkeit bzw. unverbrüchliche Bindung an das „Du“ ausspricht, kann nicht als EINSEITIGE Inbesitznahme des „Du“ durch das lyrische Ich gedeutet werden. Vielmehr setzt die klare Besitzfeststellung des lyrischen Ichs, die nicht mit einem Besitzanspruch(!) zu verwechseln ist, die Gegenseitigkeit des „Liebesbesitzes“ voraus. Beleg dafür ist, dass die absolute WECHSELSEITIGKEIT bereits innerhalb des einzelnen Verses (Vers 1), aber auch in der Gesamtaussage der 6 Zeilen wie auch in der den Inhalt unterstützenden Form zum Ausdruck kommt. Von einem einseitigen Herrschafts- bzw Machtverhältnis kann also überhaupt keine Rede sein. Der unkonventionelle Perspektivwechsel in Vers 1 kann also aufgrund dieser das gesamte Gedicht konstituierenden Gegenseitigkeit der Liebe nur als Ausdruck eines offenkundig besonderes tiefen und nicht mehr zu hinterfragenden Vertrauens in die Unverbrüchlichkeit der bestehenden Liebesbeziehung von BEIDEN SEITEN verstanden werden. Kurz: Das lyrische Ich ist sich der Zugehörigkeit und Liebe des angesprochenen „Du“ zum lyrischen Ich unbeirrbar sicher ( ebenso wie es der eigenen Liebe zum Du Ausdruck gibt) und gibt genau dieser Selbstgewissheit einen prägnanten Ausdruck durch die Kopfstellung dieser Aussage in Vers 1.
Diese Geborgenheit, diese tiefe Gewissheit des lyrischen Ichs, die eigene Liebe in der Liebe des Du gespiegelt zu wissen – dies ist die eigentliche Aussage des Gedichts.
In unserer Moderne mit ihrer notorischen Beziehungsunsicherheit erscheint diese (mittelalterliche) Geborgenheit unerreichbar, ja illusionär – und führt schnell zu einer Fehldeutung, wonach eine prononzierte Besitzfeststellung zugleich unrechtmäßiger Besitzanspruch, ja übergriffig und anmaßend erscheint.
Das gerade in der radikalen Gewissheit der Liebe des Anderen (Dû bist mîn) ein Ausdruck unverbrüchlicher GEGENSEITIGER Liebe liegt, macht das lyrische Ich in zweiten Satz, aber noch im ersten Vers unabweisbar deutlich: „…ich bin dîn“. M.B.
Lieber Hr. Larbig, lieber (Herr?) MB,
kann man nicht das Gedicht einfach nur genießen und auf sich wirken lassen, anstatt immer alles pseudo-Intellektuell zu sezieren? was geht eigentlich in solchen Köpfen vor immer alles analysieren zu müssen? Einfach mal hinnehmen wie es ist und gut iss.
Wie ist es denn? – Und »pseudo-intellektuell« ist eine Behauptung ohne nähere Begründung. Argumentationen folgen den Regeln der Aufklärung, müssen also nachvollziehbar sein. Sie stellen eine rhetorische Frage und noch eine Frage und dann »hinnehmen wie es ist«. Nur: Wie ist es denn?
Wie ich es gelernt habe bei Shin ( http://www.min-ilit.org)
Die Minnesängerinnen und Minnesänger jener Zeit wussten (noch), dass „Min“ ( aus der Ägyptischen Hochkultur-Epoche stammt der Name Min Amin für Gott, als einer seiner Namen ) der Name für den „Gott der Liebe“ war; Er ist ja reine Liebe, sonst nichts: Und sie sangen für IHN , und für Seine Geliebte Göttin Mina – für wen sonst ?
Also ist es ganz natürlich, in einem Liebesgedicht zuerst den Geliebten anzusprechen mit “ Du bist Min „…ist doch einfach wunder-bar, dieses kleine Liebesgedicht, das so viele Menschen kennen und innig lieben, wie ich auch. Ich habe es vertont und singe es zum Monochord – ganz wie seinerzeit…
würde ich MusikerInnen finden, um diese Musik des MA wieder zu den Menschen zu bringen……dann bitte melden
Christa M
Diese Herleitung aus dem Ägyptischen ist nicht nachvollziehbar. Dass im Mittelalter die ägyptische Hochkultur, geschweige denn die ägpitische Sprache, bekannt gewesen sein soll, müsste dann noch jemand belegen, der sich nicht im esoterischen Sektor bewegt. Zur Sprachgeschichte des Wortes »Minne« vgl. z. B. http://universal_lexikon.deacademic.com/104603/Minne
Der Link wurde von Autorin falsche eingegeben und funktioniert, wenn man die Domain elfenklaenge.de aufruft