Schule „muss“ sich nicht verändern; sie tut es einfach. Eine Provokation.
Als ich gerade in die Oberstufe gekommen war, wollte ich unbedingt dieses vierundzwanzig Bände umfassende Lexikon im Taschenbuchformat haben.
Als ich es dann hatte, kamen in besonders ereignisreichen Jahren Einzelbände dazu, die die Informationen im Lexikon aktualisierten.
Mir kam dieser Regalmeter an Wissen damals so vor, als ob es unmöglich sei, noch viel mehr zu wissen oder in noch kompakterer Form, Wissen zugänglich zu machen.
In der gleichen Zeit war ich zutiefst davon beeindruckt, dass Briefe an und von einem Brieffreund in Singapur in der Regel nur zwei Werktage unterwegs waren, bis sie ankamen und eine mir völlig unbekannte Welt ins Haus brachten.
Es gab für solche Brieffreundschaften Vermittlungsagenturen, die damals bei uns Jugendlichen recht beliebt waren, konnte man auf dem Wege über eine Brieffreundschaften doch Fremdsprachenkenntnissen so etwas wie Praxisrelevanz abtrotzen.
Das Lexikon steht noch immer in meinem Regal, aber weniger, weil ich davon einen Nutzen habe, sondern eher als eine Art „romantische“ Erinnerung an Zeiten, die gar nicht lange her sind, dafür aber sehr schnell vergangen sind.
Das Wissen der Welt steht heute tagesaktuell via Internet zur Verfügung.
Das Internet und Computer machen Englischkenntnisse unmittelbar praxisrelevant. Freundschaften auf Distanz werden heute via Facebook und Skype gepflegt.
Was einst ein für mich mit schier unvorstellbaren Wissensmengen gefüllter Regalmeter war, neben dem einige Zeit später noch alle damals unter dem Label „Duden“ verfügbaren Wörterbücher, zehn an der Zahl, einzogen und so auch umfassendes Sprachwissen für mich greifbar machten, kommt mir heute so vor, als seien es letztlich doch sehr bescheidene Wissensmengen gewesen. Und der Regalmeter mit gewichtigen Büchern reicht nicht im mindesten an das verfügbare Wissen in meiner Hosentasche heran, das ich immer bei mir trage.
Neben Lexikon und Wörterbüchern habe ich eine über hundert Bände umfassende Klassikerbibliothek, die in Druckform einige Umzugskisten benötigte, um transportiert werden zu können, in der Hosentasche. Das Smartphone macht es möglich.
Außerdem trage ich eine vollwertige Schreibmaschine mit mir herum, die kleiner als ein Collegeblock ist, die mir komfortablen Internetzugang erlaubt, mit der ich mit anderen Menschen kommunizieren kann.
Fotoapparat, die Möglichkeit, hochwertige Videos anzufertigen und sogar zu schneiden, ein Audiorekorder, einen Scanner mit OCR, eine vollständige Fahrplanauskunft (früher war dazu ein dickes „Kursbuch“ nötig), eine Sammlung historischen Kartenmaterials, eine mehrere hundert „Platten“ umfassende Musiksammlung etc. führe ich ständig in der Hosentasche mit mir herum.
Das alles kam mir in den Sinn, als ich über die mir kürzlich gestellte Frage nachdachte, ob Schule sich nicht verändern müsse.
Je mehr ich über diese Frage nachdenke, deren Zielrichtung ich natürlich verstehe (zu verstehen meine), um so sinnloser, an der eigentlich zu stellenden Frage vorbei gestellt erscheint sie mir.
Schule „muss“ sich nicht verändern. Das muss man nicht fordern, als ein „Muss“ in den Raum projizieren. Schule tut das einfach. Schule verändert sich. Schule ist längst vom informationstechnologischen Wandel durchdrungen und geprägt – auch dort, wo die Veränderungsresitenzen von Lehrenden noch versuchen, „alte Selbstverständlichkeiten“ gegen den „Angriff“ aus der Welt des Internets und des Hosentaschenwissens am Leben zu erhalten.
Wenn dann Lehrer und Lehrerinnen im Lehrerzimmer „ihre Klausuren von vor ein paar Jahre, die sie bislang problemlos immer wieder verwenden konnten, die jetzt aber im Internet kursieren und die sie deshalb nicht mehr verwenden können“ hochhalten, die sie bei Schülern gefunden haben, während diese Arbeit wieder einmal geschrieben wurde, so ist das ein fast tragikomischer Anblick.
Wenn Schülern und Schülerinnen der Gebrauch mobiler Endgeräte mit Internetzugang verboten wird, wirkt das zunehmend so, als würde man die Nutzung von Wörterbüchern verbieten.
Nein, Schulen sehen sich keinem „Muss“ zur Veränderung ausgesetzt. Schulen verändern sich parallel zum Leitmedienwechsel von alleine, organisch, egal ob Lehrer, Eltern, Schulträger, Kultusbehörden, Schulbuchverlage etc. sich gegen das „Wuchern dieses digitalen Unkrauts“ wehren oder ob sie sich auf den Medienwandel in der Wissensgesellschaft einlassen und Schüler dabei unterstützen, mündige Bürgern in dieser Wissensgesellschaft zu werden.
Weg also mit dem „Muss“, wenn es um Fragen der Veränderung von Schule geht.
An die Stelle dieses „Muss“ sollte man die Forderung nach Professionalität im Umgang mit diesem Leitmedienwechsel setzen und diese Professionalität gleichzeitig einfordern.
Es ist nicht die Aufgabe von Lehrern, den Leitmedienwechsel (immer noch) zu verteufeln oder einfach zu ignorieren.
Es ist Aufgabe von Lehrern, kompetent mit dem Leitmedienwechsel umzugehen, theoretisches und Anwendungswissen zu erwerben, um den Möglichkeiten und Chancen des Leitmedienwechsels auch reflektierend begegnen zu können.
Natürlich ist das mit Arbeit verbunden, aber als Fachlehrer kann man sich zum Beispiel in den Naturwissenschaften neuen fachlichen Erkenntnissen auch nicht verweigern, wenn man den eigenen Beruf wirklich ernst nimmt.
Es ist nicht so, dass man sich zurücklehnen und entscheiden kann, ob einen als Lehrer dieser Leitmedienwechsel betrifft oder nicht, ob man diesem gegenüber Kompetenzen erwerben möchte oder nicht. Diese Entscheidung mag mir als Privatperson möglich sein; will ich meinem Erziehungsauftrag angemessen nachkommen, muss ich zum kompetenten Umgang mit dem Leitmedium in der Lage sein.
Ich kann mich als Lehrer ja auch nicht weigern, Bücher oder Fachzeitschriften in die Hand zu nehmen, wenn ich den Beruf ernst nehme.
Ich stelle mir vor, Automechaniker verhielten sich wie manche Lehrer, sie würden sich weigern, von ihren mechanischen Reparaturkompetenzen auf Mechatronik umzustellen, sie würden sich weigern, den Umgang mit Computern zu erlernen, um Fehleranalysen an der Bordelektronik eines Autos durchführen zu können: Wenn ein solcher Automechaniker nicht gerade in einer Werkstatt arbeitet, die sich auf Oldtimer spezialisiert hat, würde er seinen Beruf verlieren.
Ich hielte es für keinen Eingriff in die gesetzlich verankerte pädagogische Freiheit von Lehrerinnen und Lehrern, würde eine Dienstanweisung ergehen, in der klar definiert ist, welche Kompetenzen der Leitmedienwechsel von Lehrenden fordert, damit dieser kompetent reflektiert und auch praktisch fruchtbar gemacht werden kann. Diese Dienstanweisung dürfte freilich nur von Leuten erarbeitet werden, denen man genügend Wissen und Fähigkeiten zutraut, dies angemessen zu tun, also nicht von Politikern, die sich E-Mails nach wie vor ausdrucken lassen 😉
Ich hielte es für keinen Eingriff in die gesetzlich verankerte pädagogische Freiheit von Lehrerinnen und Lehrern, bekäme jede und jeder eine Dienstemailadresse, die verpflichtend mind. an den Tagen abzurufen wäre, an denen die Kollegen in der Schule sind, wo Dienstrechner verfügbar sind.
Solange es aber nicht als seltsam angesehen wird, dass Lehrer und Lehrerinnen sich teilweise dem Leitmedienwechsel offensiv verweigern, solange nicht verbindlich eingefordert wird, dass Medienkompetenz ebenso wie Sprach- und Schreibkompetenz in allen Fächern zu fördern ist, solange wird sich Schule weiter verändern, worauf Lehrer weiter mit Restriktionen reagieren werden, um den StatusQuo zu bewahren, um die Veränderungen vielleicht doch noch zu verhindern, wodurch die Atmosphäre in den Schulen zunehmend von dem nicht reflektierten Konflikt zwischen „digitalen Selbstverständlichkeiten“ im außerschulischen Alltag und der vor diesem Alltag „geschützten“ Schule geprägt wird.
Der Leitmedienwechsel wird zu einer neuen Lernkultur führen.
Die sich mit ihm ergebenden Möglichkeiten und Risiken wollen reflektiert Einzug in die Schulwirklichkeit finden.
Um diesen reflektierten Umgang mit dem Leitmedienwechsel leisten zu können, müssen Lehrer und Lehrerinnen lernen.
Ja, das ist mit Arbeit verbunden. Aber diese Arbeit ist nicht zu vermeiden, soll sich in der Schule nicht ein Dauerkonflikt zwischen „digitalen Selbstverständlichkeiten“ (das Vorhandensein einer dienstlichen E-Mail-Adresse ist eine solche, der gemeinfreie Klassiker auf dem E-Book-Reader bzw. dem Smartphone oder dem Tablet ist gerade dabei eine solche zu werden) und analoger Beharrlichkeit festsetzen, der dem Auftrag der Schule und somit der Pädagogen in der Schule zuwider liefe.
Schule „muss“ sich nicht verändern; Schule verändert sich angesichts des Leitmedienwechsels einfach; sie tut das einfach, völlig ohne „Muss“.
Die Frage lautet also, wie sehr die an der Gestaltung von Schule beteiligten Professionellen professionell in der Lage sind, diese Veränderungen wahrzunehmen, zu beschreiben, zu reflektieren und dann in die Didaktik und Methodik der Fächer zu integrieren.
Das ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Und deshalb muss die Herausforderung noch umfassender beschrieben werden: Wie sehr sind Politik und gesamtgesellschaftliche Stimmungen bereit und in der Lage, den an der Gestaltung von Schule beteiligten Professionellen professionelle Fortbildungsmöglichkeiten zu geben, die keine Zusatzbelastungen sind, sondern durch Entlastungen an anderen Stellen eigentlich erst erwartbar und möglich werden.
Solange dies nicht geschieht, ist freilich nicht unbedingt zu erwarten, dass Lehrer und Lehrerinnen die Kraft, Energie und Bereitschaft aufbringen (können), sich den faktischen Veränderungen von Schule im digitalen Kontext zu stellen; solange ist es durchaus nachvollziehbar, dass vielen Lehrer und Lehrerinnen der an „analogen Selbstverständlichkeiten“ orientierte Schulalltag der „sicherere Grund“ zu sein scheint, auf dem sie agieren können.
Doch von all dem unabhängig: Schule verändert sich; Schule hat sich angesichts neuer „digitaler Selbstverständlichkeiten“ längst verändert.
Es ist Zeit, diese Veränderungen reflexiv und praktisch einzuholen.
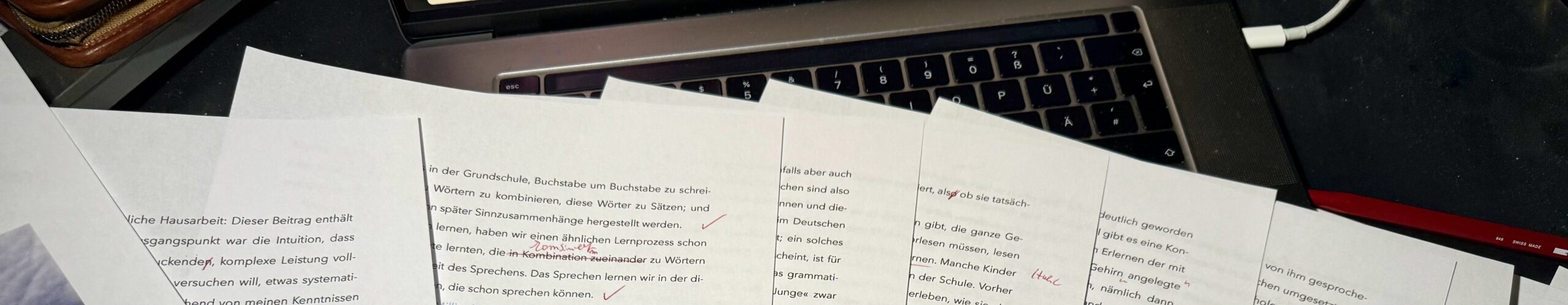
Ja. Und Nein.
Der Schlüssel ist wie so oft, die Frage: „inwiefern?“
Ich sehe es so:
1. Der Leitmedienwechsel hat längst stattgefunden. Die Frage ist tatsächlich schon lange, ob es Schule (und den anderen Bildungsorganisationen) gelingt, damit so umzugehen, dass das Bildungssystem seiner Funktion unter den neuen gesellschaftlichen Bedingungen durch den Leitmedienwechsel gerecht werden kann. Dazu ist längst klar, dass dieses bisherige System einen fundamentalen Wandel vollziehen muss.
2. Es ist überhaupt nicht gesagt, ob ihm das auch (rechtzeitig) gelingt. Systeme, die das nicht schaffen, gehen zugrunde. Andere, neu emergierende Strukturen werden diese Funktion, oder Teile davon – schlecht oder recht – übernehmen.
3. Wir leben (so Michael Giesecke u.a.) in einer Übergangsgesellschaft, die diesen Transformationsprozess in allen gesellschaftlichen Systemen bewältigen muss.
4. Wie Du, Torsten, sehe ich keine Wahlfreiheit; die Systeme können sich dieser Change-Aufgabe nicht entziehen. Aber: wenn sie sich dieser Aufgabe nicht explizit und klug stellen, passiert natürlich trotzdem etwas: nämlich wild und höchst widersprüchlich und mit vielen Blessuren und unerwünschten Effekten. Der gewünschte gelingende Transformationsprozess läuft nicht irgendwie sowieso selbstorganisierend positiv. Dafür sind die inneren Widersprüche des (Bildungs-) Systems viel zu groß!
5. Wenn wir die inhärenten Widersprüche unter den neuen Bedingungen (Digitales Zeitalter) auf einer höheren Ebene prozessieren wollen, dann müssen die Systeme das explizit und klug tun – die sog „Schwarmintelligenz“, die ja nicht „kollektive Intelligenz“ ist, tut das nicht irgendwie von alleine in die erwünschte Richtung unter Vermeidung zu vieler negativer unvorhergesehener Effekte. Der Übergang muss klug genutzt werden. Da ist eine Menge Denk- und Entscheidungsbedarf auf der Ebene „kollektiver Intelligenz“, die sowohl Voraussetzung der Lösung ist, als auch Produkt!
6. Konkret: Die Systemwidersprüche müssen benannt und zum Gegenstand der Diskussion im System werden: Wo die Regeln des System sich immer öfter zeigt als Lernverhinderung anstatt als Lernermöglichung, müssen sie geändert werden. Das geht über die Erlaubnis, Handys im Unterricht „zu Unterrichtszwecken“ (aha! Schon werden die alten Regeln als Verhinderer genutzt) anmachen zu dürfen, weit hinaus. Es geht nur vordergründig um die Devices-Frage. Es geht um Partizipation, um die Demokratisierung des nicht demokratischen Bildungsystems. Die Lernenden müssen die Verfügung über ihr Lernen bekommen, nicht bloß über das WIE, sondern auch über das WAS, MIT WEM, WO, WANN. Das – wie man sieht – geht an die Fundamente der Regeln und Strukturen, ALLES steht auf dem Prüfstand. Und wer prüft und entscheidet die Veränderungen? Das muss dabei ja auch neu geregelt werden!
7. Es findet hier also dasselbe statt, wie in der gesamten Gesellschaft. Top down geht nicht mehr. Occupy kann noch nicht, denn bottom up alleine funktioniert auch nicht.
8. Es wird ein langer Lernprozess – nicht nur der Menschen in den Systemen, sondern der Systeme selbst. Wie das geht? Was dabei herauskommt? Wir wissen es noch nicht. Es wird sich zeigen. Aber es geht keineswegs von selbst. Das einzige, was wir wissen, ist: Es MUSS!
„Die Frage lautet also, wie sehr die an der Gestaltung von Schule beteiligten Professionellen professionell in der Lage sind, diese Veränderungen wahrzunehmen, zu beschreiben, zu reflektieren und dann in die Didaktik und Methodik der Fächer zu integrieren.“
Bei aller Übereinstimmung mit dem Grundanliegen des Artikels, der übrigens sofort eine beachtliche Resonanz in einschlägigen Netzwerkkreisen bekommen hat, kann ich hier der Zielrichtung nicht folgen. Die erfassten „Veränderungen“ können nicht einfach in „die Didaktik und Methodik der Fächer“ integriert werden, sie sprengen vielmehr die bestehenden Fachdidaktiken und -methoden. Wenn der Kern des Wandels in Partizipation und Selbstbestimmung liegt, dann kann ich diesen Wandel nicht mit herkömmlicher Didaktik unterstützen. Passend dazu hat Kerstin Mayrberger gerade heute in einem schönen Artikel (www.medienpaed.com/21/mayrberger1201.pdf Online publiziert: 12. Januar 2012
Partizipatives Lernen mit dem Social Web gestalten
Zum Widerspruch einer ‹verordneten Partizipation ) gezeigt, dass die Antinomie von Selbstbestimmung der Lernenden und prinzipiell undemokratisch organisierter Schule aktuell unaufhebbar ist. Wenn man nicht hier ansetzt, besteht die Gefahr, dass die grundsätzlich sozialkonstruktivistisch nutzbaren Web2.0-Elemente integriert werden in eine Didaktik und Schulorganisation, die bestenfalls gewisse Stufen der Mitbestimmung erlauben.
@Meschede
Meine Überlegungen schreibe ich als Praktiker. Ich schreibe als jemand, der genau mit dem zu tun hat, was Kerstin Mayerberger treffend formuliert: „Ein selbstorganisiertes Lernen, wie es im Web 2.0 stattfinden kann, scheint somit im heutigen, schulischen Kontext auf breiter Front (noch) nicht realisierbar.“ (S. 15)
Es mag ja sein, dass die Fachdidaktiken gesprengt werden, aber ich habe mit den Phänomenen der Veränderung von Schule hier und heute Unterricht zu gestalten. Da wird nichts gesprengt, da werden erst einmal die digitalen Technologien im Unterricht genutzt, ganz pragmatisch.
DIe damit verbundenen faktischen Veränderungen, die zu neuen Didaktiken und Methodiken führen, ergeben sich aus dieser Integration von alleine, solange der Lehrer in der Lage und bereit zur Reflexion dieser Phänomene ist. Es geht mir also darum, die „in den Dingen liegende“ Logik nachzuvollziehen. – Und ja, damit formuliere ich gleichzeitig ein Kriterium für mein Professionalitätsverständnis im Lehrerberuf.
Davon abgesehen sind in der Gegenwartsdidaktik partizipative Strukturen vor allem über die Koppelung mit der Methodik längst möglich und ausbaufähig.
Werde über meine eigenen partizipativ wirkenden Methodiken demnächst mal einen Blogartikel schreiben.
Wenn du den Begriff der Integration als „Anpassung“, „Einfügung in etwas“ verstehst, hast du mit der Kritik recht. Mein Integrationsbegriff hat eher etwas vom Synthesebegriff der Dialektik.
„die eigenen partizipativ wirkenden Methodiken“ klingt schon etwas bevormundend. Oft verstehen auch in meinen Fortbildungen Lehrer unter „Partizipation“ und „Beteiligung“ usw. zunächst gar nicht Kategorien der Demokratie, sondern schlicht: „Die Schüler sollen besser mitarbeiten (an dem, was ich ihnen vorsetze.)“
Ganz entsetzt ist man dann, wenn man aufgeklärt wird, dass es sich darum handelt, dass „Mitarbeit“ und „Engagement“ nicht mehr ohne Selbst- oder wenigstens Mitbestimmung der SuS zu haben ist. Und diese ist – wie ich oben gesagt habe – eben nicht durch Unterrichts-Methoden im Klippertschen Sinne zu kriegen. „Hier an dieser Stelle dürft ihr in meiner Planung mal 10 minuten euch einbringen, zusammenarbeiten. Aber es soll bitte herauskommen, was ich als Output geplant habe, an der Planung selbst werdet ihr natürlich nicht beteiligt, denn davon versteht ihr nichts.“ Das ist die Logik. Torsten, Du magst als Lehrerindividuum einen Unterricht machen, der, was Mitbestimmung angeht, weit darüber hinausgeht. Es geht hier ums System, nicht um eine einzelne Lehrerperson. Fakt ist, dass je mehr man die Schüler an ihrem eigenen Lernen mitbestimmen lässt, desto mehr gerät man in Widerspruch zu den Systemeigenschaften und Regeln, desto deutlicher wird das von Kant („Wo ist die Freiheit bei alle dem Zwange“) und Luhmann benannte Systemdefizit. Und dieser Widerspruch ist dann zu spüren! Entweder in Spannungen und Konflikten mit den systemangepassten KollegInnen (das habe ich sehr deutlich erlebt), oder in Spannung und Konflikt mit den Vorgesetzten und der Schuladministration (siehe Sabine Czerny).
Diese Spannungen und Konflikte sind nicht zu vermeiden! Das heißt immer: Nur wer felsenfest davon ausgeht, dass es einen guten Sinn macht, gegen die Systemregeln zu verstoßen, der hält diese Spannungen überhaupt aus und ist in der Lage, die Konflikte durchzustehen. HEISST: es geht mitnichten irgendwas in Richtung Demokratie in diesem Bildungssystem von selbst. Ganz im Gegenteil! Weil man gerne Spannungen und Konflikte vermeidet, was ja ganz normal ist und als sozialverträglich prämiert wird, und (wenn man nicht einen an der Waffel hat, wie z.B. ich) dann macht man das nicht, was nötig ist: nämlich die Systemgrenzen zu expandieren.
Empfehle Lektüre Engeström – ist sehr aufschlussreich, theoretisch wie empirisch.
Zwei Gedanken bleiben bei mir gerade hängen – 1. Das System – es „muss“ unterstützt werden, damit eine Erkenntnis nicht nur einem Individuum nutzt, das eine andere Art verinnerlicht hat oder auf dem Weg ist, genau das zu tun. Dazu braucht es manchmal gar nicht viel – eine Ghostwriter bei der Antwort auf eine dienstliche Anweisung, ein Blog, mit dem jemand sofort arbeiten kann, ein WLAN, was technische Grundlage für weitergehende Schritte bildet oder einfach nur den Lehrpersonen selbst das allgegenwärtige Netz ermöglicht. Diese Dinge „müssen“ in meinen Augen geschehen, damit überhaupt der Raum für weitere Entwicklungen geschaffen ist und Rechtfertigungsgründe für Vermeidungsstrategien reduziert werden auf persönliche Haltungen und nicht z.B. auf nicht vorhandene Technik. Darüber kann man dann ganz anders reden. Es geht langsam los. 2. Prozess – der „muss“ auch, nämlich zumindest katalysiert werden, weil die „Bedrohung“, die in Lisas Formulierung „geht zugrunde“ liegt, immer größer wird und immer schneller und schneller näherkommt. Ist es denn so, das 10000nde angehenende Lehrpersonen bereitsstehen, die dem neuen Land zugewandt sind und die mit ihren SuS in das damals zitierte „Boot“ steigen? Von wo aus die Katalyse kommen kann, weiß ich nicht. Ich nehme aber wahr, dass hier bei uns gerade eine erfolgreich ausgefochtene Diskussion mit der Obrigkeit unglaubliche Katalysen ausgelöst hat und sogar jetzt schon Lehrerverbände von der Notwendigkeit lerntauglicher digitaler Artefakte sprechen. „Resistance ist not futile“, sondern Staatsbürgerpflicht im Sinne der uns anvertrauten Menschen. Außerdem gibt es jetzt Menschen in der Schule (u.a. meine Kinder). Deswegen fände ich eine gewisse Beschleunigung so verkehrt nicht.