Im Gehege des Deutschunterrichts oder: Der Zoo und die Wildnis
„Kurzgeschichten erfreuen sich im Deutschunterricht seit jeher einer großer Beliebtheit“,
schreibt Reiner Werner auf Seite Vier der Einleitung des Schroedel-Bandes „Deutsch SII (Kompetenzen, Themen, Training), Kompetent in Kurzgeschichten“, der 2009 erschienen ist. Er zeigt damit, möglicherweise, ohne sich dessen bewusst zu sein (?), schon im ersten Satz des von ihm erarbeiteten Bandes, die Ambivalenz des Einsatzes von Kurzgeschichten auf: Einerseits gehören Kurzgeschichten mit Gedichten zu den am häufigsten im Deutschunterricht eingesetzten literarischen Kunstwerken. Andererseits handelt es sich dabei aber um literarische Gattungen, die außerhalb der Schule so gut wie gar nicht gelesen werden.
In der Schule werden diese „kleinen“ literarischen Gattung „gehegt“ und „gepflegt“; auf dem Buchmarkt spielen sie eine kaum wahrnehmbare Rolle. „Gehegt“ und „gepflegt“ – oder vielleicht doch eher missbraucht, vergewaltigt und getötet? Dieser Frage will ich hier nachgehen. Dabei nehme ich das Vorwort in dem schon zitierten Schroedel-Band als Leitfaden, weil es sich um 1. um einen gerade erschienenen und 2. um einen von seiner Zielrichtung her an Komptenzen orientierten Band handelt, der zumindest davon Zeugnis gibt, wie sich ein Schulbuchverlag „Kompetenzen“ im Umgang mit Literatur vorstellt.
Entscheidend ist für mich eigentlich immer, was Lehrer und Didaktiker – nein, es ist kein Zufall, dass ich diese beiden Begriffe nicht synonym gebrauche – zum Thema der Methodik zu sagen haben. Dazu Rainer Werner:
„Der moderne Literaturunterricht zielt darauf ab, den Schülern wichtige Kompetenzen der Textinterpretation zu vermitteln, die sie in die Lage versetzen, ihre Fähigkeiten im Umgang mit Sprache und Literatur stetig zu erweitern.“ (a.a.O., S. 5.)
Ja, genau so ist es und so muss es auch sein, will ein Schüler oder eine Schülerin Klausuren in der Oberstufe bestehen und schließlich den Anforderungen des Abiturs entsprechen. Dementsprechend geht der Autor dann noch kurz darauf ein, welchen Grundsätzen sein Ansatz folgt, der die „herkömmliche lehrerzentrierte Unterrichtsform“ auflockern will, in dem so „schülerzentrierte“ Methoden, wie Gruppen und Partnerarbeit, aber auch kreative Schreibaufgaben eingesetzt werden, ohne die „strukturierende Hand des Lehrers“ aus dem Blick zu verlieren, dessen „überlegenes Wissen“ nun nicht mehr nur eingesetzt werde, „um den Gang der Interpretation immer zum ‚richtigen‘ Ziel hin zu steuern“ (ebd.). Außerdem behauptet Werner auch noch richtig, dass Lehrer Schülern das fachliche Wissen voraus hätte, aber auch, dass dieses Voraus ebenso für die Erfahrung im Umgang mit literarischen Texten gelte.
Und dann werden all die Wege genannt, die Lehrer (und Lehrerinnen) mit dem nun vorgelegten Band gehen könnten. – Wer würde von einem Lehrerband zum Thema „Kurzgeschichten“ auch etwas anderes erwarten, stimmt Werners Darstellung des Literaturunterrichtes doch ziemlich genau mit einer zumindest nach wie vor weit verbreiteten Wirklichkeit des Deutschunterrichts überein, die man sich bei den genannten und faktisch so in Prüfungen ja wirklich erwarteten Zielen, auch kaum anders vorstellen kann.
Für Lehrende ist das im täglichen Prozess der Reflexion auf ihren Unterricht ein wirklich guter Band zum Thema Kurzgeschichten geworden. Und für den Band spricht auch, dass Reiner Werner scheinbar alle Unterrichtsvorschläge am Berliner John-Lennon-Gymnasium ausprobiert hat. Die Inhalte sind also erfahrungsgesättigt und kommen zudem Lehrerinnen und Lehrern entgegen, die sich zwar der Kompetenzenorientierung des Unterrichts nicht entziehen wollen, gleichzeitig aber auch, um ihrer Verantwortung gerecht werden zu können, Schülerinnen und Schüler kompetent im Umgang mit literarischen Texten zu machen, die strukturierenden Fäden in den Händen behalten wollen. Das stört mich nicht, das gehört nach wie vor zum Alltag des Deutschlehrers – und die Frage nach der Lehrerrolle im Deutschunterricht soll hier auch gar nicht im Vordergrund stehen, so sehr sie im Hintergrund immer mitschwingen mag.
Viel mehr interessieren mich hier zwei andere Fragen:
- Wo kommen in solchen Ansätzen, wie er von Reiner Werner im Vorwort des Bandes „Kompetent in Kurzgeschichten“ vertreten wird, die Schüler und Schülerinnen vor?
- Welche Rolle haben literarischen Kurzformen im Deutschunterricht.
Beginnen wir mit der zweiten Frage:
Die Rolle von literarischen Kurzformen im Unterricht steht in einem deutlichen Gegensatz zu der Rolle, die diese Textsorten im Alltag durchschnittlicher Leser und Leserinnen spielen. Sie werden gewählt, weil sie gut in den Zusammenhang von Unterrichtsstunden passen.
Darüber hinaus kann an literarischen Kurzformen in kompakter Form Wissen im Umgang mit Texten vermittelt werden. Das mögen ehrenwerte Ziele und ein nachvollziehbarer Mehrwert von Gedichten und Kurzgeschichten sein, aber am wichtigsten finde ich, dass diese für mich literarisch anspruchsvollsten literarischen Gattungen im Deutschunterricht am Leben erhalten werden. Die Schule übernimmt für diese literarischen Gattungen, insbesondere für Kurzgeschichten, kommen Gedichte doch immerhin auf den MP3-Playern der Schülerinnen und Schüler als „Lyrics“ nach wie vor in Massen vor, in etwa die Rolle, die Zoos für vom Aussterben bedrohte Tierarten übernehmen: Es wird ein Schauraum geschaffen, in dem man geschützt und strukturiert und angeleitet, von Wärtern gehegte und gepflegte Tiere betrachten kann, die einem in freier Wildbahn oftmals kaum noch begegnen. Die Gehege werden mit Tafeln versehen, die alles erklären – und der Besucher kann den Zoo mit dem guten Gefühl verlassen, etwas gelernt zu haben. Außerdem wird das Einsperren der Tiere mit der in Zoos stattfindenden wissenschaftlichen Arbeit begründet, die ja in Einzelfällen auch wieder zur Auswilderung der Tiere führen kann.
Sicher, eine authentische Begegnung mit einer Wildkatze, einer Giftschlange oder einem Krokodil sieht anders aus. Sie ist aufregender und deutlich gefährlicher als im Zoo. Und spätestens dann, wenn ein solches Tier seziert wird, ist klar: Jetzt geht es um die anatomische Zerlegung einer Leiche.
Kurzgeschichten (Gedichten und eigentlich fast jeder literarischen Form) ergeht es im Deutschunterricht nicht besser. Die unmittelbare, „gefährliche“ Begegnung mit Literatur wird höchstens noch methodisch geleitet zugelassen, die Frage nach dem ersten Leseeindruck der Schülerinnen und Schüler wird fast zu einer rhetorischen Frage, da sie oft beim weiteren Umgang mit einem literarischen Kunstwerk kaum noch eine Rolle spielt. Dort, wo das „Wilde“ und das „Gefährliche“ der Literatur zu Hause ist, dort, wo ein Mensch mit seiner Biographie auf einen Text trifft und aus dieser existentiellen Begegnung etwas wachsen kann, liegen die Seziermesser der Textanalyse schon bereit, mit denen das möglicherweise im ersten Leseeindruck aufgeflackerte Leben, das in der Begegnung von Text und Leser bzw. Leserin gezeugt wird, schnellstmöglich auf funktional einsetzbare Kompetenzen hin beschnitten wird.
Natürlich wird ein Deutschlehrer vermutlich mehr gelesen haben als die Jugendlichen. Natürlich hat die Deutschlehrerin aus dem Studium mehr Fachwissen als Schülerinnen und Schüler. Aber kann man in der unmittelbaren Begegnung mit Literatur je erfahrener sein, abgesehen von der Erfahrung, was Literatur mit einem „echten“ Leser machen kann, als die Schülerinnen und Schüler?
Wenn es stimmt, dass jeder Text in der Begegnung mit jedem Leser und jeder Leserin „neu“ entsteht, „neu“ gelesen wird; wenn es stimmt, dass in der Begegnung des Textes mit dem Lesenden ein Text völlig neue Seiten Preis geben kann, dann wertet die Behauptung, dass ein Lehrer „besser“ lesen könne diese Leseerfahrungen ab – und zwar so sehr, dass es Schülerinnen und Schülern eine große Herausforderung ist, wenn ein Lehrer versucht, sie wirklich mit dem Text in eine Begegnung zu bringen, aus der möglicherweise das nachgelagerte Interesse an den Techniken erwächst, derer sich ein Autor (ob nun gezielt oder nicht) bedient hat.
Oft steht die Aussage, dass das Ziel beim Umgang mit Literatur in der Schule „sowohl die persönliche Erfahrung der Leser bzw. Schüler in die Auseinandersetzung mit dem literarischen Text einzubeziehen, als auch ein angemessenes Verständnis für die Aussage und Form solcher Texte zu fördern“ ((Lensch, Martin (2000): Spielen, was (nicht) im Buche steht. Die Bedeutung der Leerstelle für das literarische Rollenspiel, Münster: Waxmann 2000, S.11)) im didaktischen Vordergrund des Deutschunterrichtes stehen müsse, zwar im Zentrum literaturdidaktischer Seminare, seltener aber im Zentrum des literarischen Zoos des Deutschunterrichtes.
Dies gilt insbesondere, wenn das Unplanbare der persönlichen Erfahrung der Leser in der Begegnung mit einem Text ernst genommen wird, da der Unterricht dann nur noch in Grenzen planbar ist, sobald die Schüler und Schülerinnen erst einmal wieder gelernt haben, dass diese persönlichen Eindrücke, Emotionen und auch Langeweilen, relevant für ihre Begegnung mit einem literarischen Kunstwerk sind.
Längst aber hat sich das „Wilde“ in der Begegnung mit Literatur andere Orte als die Schule gesucht, in der selbst Büchners „Woyzeck“ zu einem harmlosen Schmusekätzchen wird, die Leidenschaft, die in Dramen wie „Don Carlos“ wütet, auf den Tisch des nach Stilmitteln suchenden Pathologen gelegt wird, das Sozialkritische eines Brechts in der Langeweile von Zeitgeschichte ersäuft.
Das „Wilde“ findet außerhalb der Schule statt: In der gierigen Lektüre von „Harry Potter“ hat es sich gezeigt; in der Verwechslung von Dichtung und Wahrheit, die manche Leser dazu brachte, Dan Browns (schlecht geschriebenes) Buch „Sakrileg. Der Da Vinci Code“ als ein von seinen Aussagen her vielleicht richtiges Werk zu betrachten; im Zittern beim Lesen von Thrillern, bei denen die meisten Erwachsenen die Frage stellen, ob die Jugendlichen denn schon in dem Alter sind, so etwas zu verkraften; in der Liebesschnulze, dem Fantasyroman etc., die in der S-Bahn aus der Tristesse des Zuges entführen und Phantasien ebenso wie Größenphantasien befriedigen.
Zugegeben: Die Literaturauswahl in den Schulen ist meist tatsächlich so, dass literarische hochwertige Werke gelesen werden. Aber wo bleibt das Entsetzen, wenn Faust Gretchen in den Tod treibt, wo der Aufschrei, wenn ein Hauptmann oder ein Doktor mit Woyzeck ihr „Spiel“ treiben, wo das Sehnsuchtslechzen, wenn die Romantiker der Wirklichkeit mehr als nur die Kälte der radikal entmystifizierenden rationalen Zugangsweise abtrotzen wollen? – Für solche emotionalen Regungen scheint in der Schule kein Platz zu sein, so wenig, wie im Zoo in der Regel Platz für die „Angst“ ist, wenn man einem wilden Tier nur durch einen Zaun oder eine Glasscheibe getrennt gegenüber steht.
Und das gilt auch (und besonders) für Kurzgeschichten, in denen so oft massive existentielle Fragen im Zentrum stehen und hoch konzentriert auf Leser und Leserinnen treffen wollen. Was hier an Destillat der Wirklichkeit hochprozentig eingeschenkt wird, macht dennoch selten besoffen, weil schnell das konservierende und die Kost ungenießbar machende Formalin der analytischen Konservierung über die Texte geschüttet wird, bis selbst die Begegnung mit den Texten und deren eigentlich oft existentiellen Herausforderungen und Reflexionspotentiale in Formalia erstickt ist.
Kurzgeschichten und Gedichte sind aber zuerst Kunstwerke! Sie sind keine harmlosen Tierchen, die man zu Demonstrationszwecken halten kann, ohne dass sie ihren Reiz und ihre Faszination verlieren.
Kurzgeschichten und Gedichte sind nicht zuerst Übungen, an denen Autoren und Autorinnen ihre formalen Fähigkeiten erproben wollten, sondern, oft hochgradig existentielle Auseinandersetzungen der Autoren und Autorinnen mit einer Wirklichkeit, der sie ausgesetzt sind.
Die so oft im Unterricht benutzten Kurzgeschichten der späten 40er und der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts sind keine Darstellung der Nachkriegszeit, sondern existentielle Auseinandersetzungen mit den Schrecken dieser Zeit. Paul Celan schrieb keine Gedichte, die zuerst der Analyse dienen sollten. „Todesfuge“ ist eine existentielle Auseinandersetzung mit dem Schrecken, der Celan später in den Selbstmord trieb. Und ähnliches gilt für so ziemlich alles, was im Deutschunterricht gelesen wird (werden soll): Büchners verzweifelter Aufschrei gegenüber der Ungerechtigkeit zu Zeiten der frühen Industrialisierung im „Woyzeck“, Schillers massive Abarbeitung an einer Biographie zwischen unaufgeklärten Fürsten und Freiheitsdrang, die radikale Erfahrung der Zerstückelung des Menschen im Kontext der Massenmenschenhaltung in von der Industrialisierung lebensfeindlich gewordenen Städten usw.
Schullektüren waren einmal „wilde“ Bücher. Goethes „Die Leiden des jungen Werthers“ rief zur Zeit des Erscheinens Massenphänome zwischen Kleidungsstil und Selbstmord hervor; Heinrich Mann galt als „gefährlicher“ Schriftsteller, weil er nicht nur schrieb, sondern auch noch Kommunist war; Kafka durchlebte in der künstlerischen Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Zeit die Verzweiflung an sich selbst und seiner Zeit. – Wo ist davon noch etwas im üblichen Deutschunterricht zu spüren, der Kompetenzen in den Vordergrund stellt, die letztlich eben doch nichts anderes sind als Anleitungen zum Gebrauch von Werkzeugen zur Zerlegung von Texten und eben nicht die Hinführung zu der Fähigkeit sind, sich einem Text existentiell auszusetzen?
„Kurzgeschichten erfreuen sich im Deutschunterricht seit jeher einer großer Beliebtheit“,
richtig. Das gilt auch für Gedichte. Aber die Beliebtheit hat nichts damit zu tun, dass hier Hochprozentiges genossen wird und existentiell „besoffen“ macht, sondern darin, dass es nun einmal leichter ist, eine Maus zu fangen und mit dem Skalpell in relativ kurzer Zeit zu zerlegen als es dies bei einer Wildkatze, einer Giftschlange oder einem Elefanten der Fall ist. Etwas Kleines bzw. klein Gemachtes kann leichter im Gehege gehalten werden als etwas Großes uns Wildes.
Das Resultat ist verheerend: Die Kunstformen, die die größten Herausforderungen an ihre Verfasser in Hinsicht auf (Ver)Dichtung stellen, werden so Kunstformen, die im außerschulischen Leben so wenig anzutreffen sind, wie Wölfe in deutschen Wäldern. Wildkatzen werden zu Hauskatzen konditioniert; der revolutionäre Schrei nach Gerechtigkeit wird zum historischen Quellchen herab gewürdigt.
Nein, ich gehöre nicht zu denen, die meinen, dass Literatur die Welt verändern könnte. Aber ich gehöre zu denen, die Prousts Diktum am eigenen Leib erfahren haben, dass der Leser, wenn er wirklich liest, immer ein Leser seiner selbst sei.
Kompetenter Umgang mit Literatur? Ja, dazu gehören auch alle Fragen nach den Techniken, die Literatur wirksam machen, nach Stilmitteln, die die Wirkung von Literatur begründen – und auch nach den oft als existentiell empfunden „Kompetenzen“, die es ermöglichen, Prüfungen zu bestehen.
Doch die wichtigste, handlungsorientierende Kompetenz im Umgang mit Literatur ist die Kompetenz, sich literarischen Texten überhaupt mit Haut und Haaren auszusetzen zu können, um so etwas über sich selbst und die Welt zu erfahren.
Es ist immer das „Ich“, das liest, das einen Text erlebt oder in ihm die eigene Gelangweiltheit erfährt. Doch dieses lesende „Ich“ muss ermutigt werden, seine eigene Auseinandersetzung mit einem literarischen Werk auch zuzulassen, sie als wertvoll für das Leben des Textes, für dessen Rezeptionsgeschichte zu erfahren, findet das lebendige, wilde und eben nicht immer vom Lehrer oder von der Lehrerin voraussehbare Leben eines Textes doch genau in dieser Begegnung eines Lesers oder einer Leserin mit einem Text statt, in einem letztlich unverfügbaren Aufeinandertreffen. Die Aufgabe des Deutschunterrichtes ist es dann, diese Begegnung kommunizierbar zu machen, die Kompetenz zu vermitteln, anderen, die diese individuelle Begegnung möglicherweise ganz anders erleben, von diesen Erfahrungen nachvollziebar berichten zu können. Hier, und erst hier, kommen all die Kompetenzen ins Spiel, die Deutschunterricht natürlich auch vermitteln muss: Die Fähigkeiten, die notwendig sind, um Dritte an den eigenen Erfahrungen mit einem Text Anteil zu geben, also auch die Begründung und Überprüfung des subjektiven Leseerlebnisses gegenüber anderen – nicht, um diese von der eigenen Wahrnehmung als die „einzig richtige“ zu überzeugen, sondern um die Differenz im Umgang mit Texten als eine solche zu erleben, die den eigenen Blick bereichert und möglicherweise sogar verändert oder auch als sehr persönlichen relativiert.
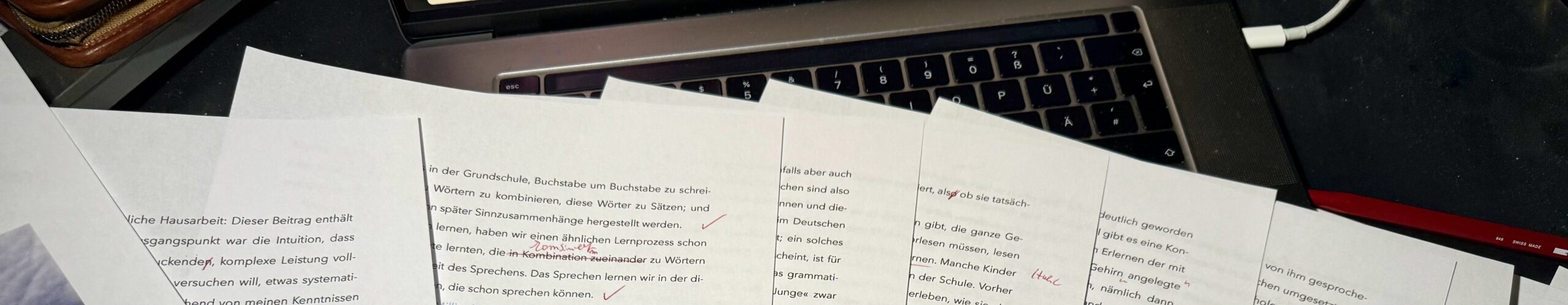
Ein großartiges Plädoyer für die Realbegegnung beim Lernen!
„Die unmittelbare, „gefährliche“ Begegnung mit Literatur wird höchstens noch methodisch geleitet zugelassen, die Frage nach dem ersten Leseeindruck der Schülerinnen und Schüler wird fast zu einer rhetorischen Frage, da sie oft beim weiteren Umgang mit einem literarischen Kunstwerk kaum noch eine Rolle spielt.“
Du bringst es auf den Punkt, wie Schule allgemein funktioniert. Denn das ist ja nicht nur ein Problem des Deutschunterrichts oder ein Problem des Unterrichtsgegenstands Novelle.
Die „Durchdiaktisierung“ und Instrumentalisierung von Gegenständen der Realität zum Zwecke der „Bildung“ zerstört häufig die Freude an den Gegenständen selbst. Die Schüler befriedigen ihr grundlegendes Bedürfnis, sich selbst in Beziehung zur Realität zu setzen, Gewinn für sich zu holen, zu Recht außerhalb dieser veranstalteten – im wörtlichen Sinne! – Zwangsbegegnung. Und man muss unter den Bedingungen der Verschulung von Kultur noch froh sein, wenn sie es überhaupt tun. Als Musiklehrerin weiß ich ein Lied davon zu singen, wie traditioneller Unterricht die Freude der Schüler an Musik für den Rest ihres Lebens vergällen kann – aller Absichtserklärung der Didaktiker zum Trotz.
Tschuldigung, dass ich mich gleich nochmal melde, aber hier habe ich so sehr Verwandtes gefunden – zwar bezieht es sich auf Novels (also zu deutsch: Romane), aber das Problem und die Einsichten sind dieselben:
Have you ever read a novel that affected your life? fragt Marc Hector in Psychologie Today:
http://www.psychologytoday.com/blog/novels-poetry-and-psychology/200910/have-you-ever-read-novel-affected-your-life
Wieso Tschuldigung? Das ist ein großartiger Link. Danke dafür und es wäre schade gewesen, wenn du ihn hier nicht noch als Ergänzung gepostet hättest. Das Thema scheint ja gerade in der Luft zu liegen.
Thema liegt in der Luft. Genau! Alles, was mit der Sinnfrage zu tun hat – und dieses hat es ja genauso. Nämlich mit der Frage, die bei allen Gegenständen, die in der Schule gelernt werden sollen, implizit oder explizit von den Schülern gestellt wird: „Was hat das mit mir und meinem Leben zu tun?“ Aber davon hatten wir’s ja schon 😉
„Where the wild things are“ – wäre ein schöner Titel für deine Beschreibung der Welt der Literatur. Ich kann dir nur zustimmen in deiner Forderung danach, eine unverkopfte Begegnung mit Literatur zuzulassen, ja zu fördern.
Eines der Probleme dabei ist, dass Schüler oft abblocken und nach den Dingen fragen, auf die man Punkte bekommt. Da liegt es dann an der Lehrkraft, einiges klarzustellen:
1. Wenn Literatur und ein Leser aufeinandertreffen, muss nicht notwendigerweise das herauskommen, was im Lehrerhandbuch steht.
2. Fachbegriffe sind Hilfsmittel, die dazu dienen, die Wirkung der Literatur auf den Leser in den Griff zu bekommen – manchmal geht es ohne, manchmal besser mit.
3. Freude an der Literatur kann man lernen – wie man auch lernen kann, gutes Essen mehr zu mögen als Fastfood. Das setzt aber voraus, dass man sich damit beschäftigt.
Der Lehrer hat natürlich einen Vorsprung aufgrund seiner Leseerfahrung; das zu leugnen wäre unehrlich. Was er den Schülern ermöglichen muss, ist – nachdem sie den Text für sich entdeckt haben – die Einordnung in die Tradition: Ist das ein Text, der einer bestimmten Konvention entspricht oder bricht dieser Text mit herkömmlichen Formen? Spielt der Text mit direkten oder indirekten Zitaten? Was bewirken die sprachlichen Bilder – worauf spielen sie an?
Dies sind Aspekte, deren Beherrschung man nicht von vornherein bei Schülern erwarten kann (in unterschiedlichem Maß, je nach Alter). Hier ist die Kreativität des Lehrers gefragt: Wie bringe ich das zusätzliche Wissen, das der Begegnung mit diesem Text noch zusätzliche Tiefe verleiht, an den Mann?
Das kann im Unterrichtsgespräch/Lehrervortrag geschehen, das kann in geschickt formulierten Arbeitsaufträgen in Gruppenarbeit erarbeitet werden oder in Kombination mit einer materialgestützten Recherche (Sekundärliteratur im Klassenzimmer, in der Schulbibliothek, im Internet) – wie auch immer.
Der Text muss dabei nicht „zerlegt“ oder „zerredet“ werden – wenn man durch fundierte Betrachtung eines Details noch besser erkennt, wie der Text wirkt, dann schadet das dem Ganzen keineswegs (da schließe ich mich Brecht an).
Ich finde es immer schade, wenn ich Schüler verwundert sagen höre: „Bei Herrn X (oder Frau Y) mussten wir immer etwas hineininterpretieren.“ Aber ich höre das in letzter Zeit seltener. Ein Silberstreif am Horizont?