Unterricht geht durch den Magen oder: Mein Beitrag zur Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“
Mein Beitrag zu der von mir selbst ausgerufenen Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“!
Unterricht geht mir durch den Magen. Ob eine Stunde gut gelungen oder ein Stundenkonzept grandios gescheitert ist, merke ich tatsächlich sehr schnell als „Gefühl in der Magengegend“.
Von einer strukturierten oder gar in Routinen verpackten Reflexionspraxis ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts auf weiter Flur zu sehen.
Bei diesen eindeutigen Fällen, die durch Gasteromantie 😉 angemessen in den Vordergrund drängen, scheint es auf den ersten Blick auch nicht unbedingt nötig, in Reflexionsprozessen zu versinken.
Stunden, die so schnell vorübergehen, dass auch Schüler verwundert sind, dass die Stunde schon vorbei ist, tragen ihr Geheimnis ziemlich öffentlich zur Schau: Die Schüler fanden Wege, ihr Eigeninteresse an einem Lerngegenstand zu aktivieren und auszuleben.
Grandios gescheiterte Stunden bedürften tiefergehenden Betrachtungen, welche aber sauer aufstoßen, nachdem sich eh schon die Unzufriedenheit in der Magenregion eingenistet hat.
In beiden Fällen findet sich leicht eine Lücke, um der (routinierten) Reflexion zu entkommen.
Weit weniger eindeutig ist die Frage nach gelungener Ermöglichung des Lernens der Schülerinnen und Schüler dann zu beantworten, wenn sich kein eindeutiges Magengefühl bildet. Bei mir sind das viele Stunden. Und auch diese Stunden können dem Reflexionsprozess durch die Lappen gehen, denn wo nichts auffälliges ist, scheint auch kein Reflexionsbedarf zu bestehen.
Ohne sich lange umzuschauen, haben sich bis hierher die Strategien zur Vermeidung der Praxisreflexion bereits unumwunden gezeigt.
Ich kenne diese Strategien.
Um dann nicht irgendwann im so erzeugten Reflexionsstau zu landen und weder voran- noch zurückzukommen – ein Zustand, dessen Erreichbarkeit in Feriennähe deutlich leichter als nach Ferienende ist –, ist eine Reflexionsroutine hilfreich.
Routinen sind nicht nur immer wiederkehrende Abläufe. Es handelt sich vielmehr um Fähigkeiten, die mit der Erfahrung wachsen und erlauben, eine Tätigkeit so auszuführen, dass sie selbst nicht mehr im Zentrum des Tätigseins steht, sondern eine Konzentration auf das erlaubt, was mit der Tätigkeit erreicht werden soll.
Für die Reflexion meiner Praxis im Beruf als Lehrer brauche ich also Techniken, die ich als solche beherrsche, die ich als Techniken nicht mehr „merke“, bei denen ich nicht jeden Schritt überlegen muss, der als nächstes zu gehen ist.
Ein Reflexionsbogen kann zum Beispiel eine solche Rolle übernehmen und das Nachdenken nicht nur in eine Routine überführen, sondern durchaus auch effizient gestalten.
Ich nutze solche Reflexionsbögen nicht. Sie sind mir zu effizient, führen also eher zu einem engen Blick auf mein Handeln in der Lehrerrolle.
Welche Routinen nutze ich nun aber? Oder haben die oben genanten Routine-Vermeidungsstrategien mich fest im Griff?
Bereits die Formulierung, dass ich Routinen (Plural) verwende und mich nicht auf eine Routine beschränke, bringt es auf den Punkt: Reflexionsprozesse auf mein Handeln in der Lehrerrolle bedienen sich unterschiedlicher Werkzeuge und Wege, die ich meine, einigermaßen sicher (routiniert) nutzen und gehen zu können.
Bei grundsätzlichen Fragestellungen, nutze ich die Schriftform.
Fragen dieser Reflexionsprozesse können pädagogischer Natur sein (Wie sieht eine verantwortliche Medienpädagogik in der Schule aus?) oder didaktischen Charakter haben (Wie nutzen wir digitale Endgeräte sinnvoll in jener oder dieser Unterrichtssequenz?). Es kann sich um Sachanalysen im Vorfeld des Didaktisierens handeln (Wie interpretiere ich dieses Gedicht xyz?), aber auch um die Überprüfung von Annahmen, die ich im Rahmen meiner (dynamischen, sich eigentlich ständig verändernden) Lerngruppenanalysen aufstelle.
Früher fanden diese Reflexionen grundsätzlich handschriftlich statt. Heute gibt es da eine Mischform, in der es keine festgelegten Vorgaben gibt. Je nach Tageslaune schreibe oder tippe ich.
Darüber hinaus ist die Form des Audiofiles hinzu gekommen. Wenn ich über Ereignisse, denen ich als Lehrer begegnet bin, nachdenke, mache ich das eigentlich schon immer auch beim Spazierengehen. Seit ich Podcasts für mich entdeckt habe, habe ich auch entdeckt, dass ich beim Aufzeichnen meiner Gedanken in gesprochener Form, gut über Zusammenhänge nachdenken kann. Ein solches Vorgehen ist zwar nicht mit einer Supervision zu vergleichen, leistet mir aber gute Dienste. (Bei dieser Art der Reflexion geht es in der Regel um Phänomene, die weniger mit konkreten Schülern / Schülerinnen zu tun haben, sondern eher mit Unterrichtskonzeptionen, Überlegungen zu Projekten, sodass in den Audiofiles vor allem Unterrichts- und Projektplanung stattfindet.)
Ein Dauerprozess der Reflexion ist übrigens durch Aktivitäten in sozialen Netzwerken hinzu gekommen. Dort sind Anmerkungen, Überlegungen, Fragen zwar so gestellt, dass sie öffentlichkeitskompatibel sind und nicht unbedingt etwas über konkrete Motive hinter den Fragen verraten, aber meine Praxis wurde durch diese Vernetzung mit Kollegen, mit Bildungsmenschen aus anderen „Branchen“ und mit anderen Zielgruppen (zum Beispiel im Corporate-Learning-Bereich) schon oft durch Anregungen von außen ergänzt, korrigiert oder auch mal über den Haufen geworfen, wenn ich merkte, dass bestimmte Methodiken mit bestimmten Lerngruppen nicht funktionieren (können).
Viele Blogartikel haben ihre Wurzeln in solchen Reflexionsroutinen, aus denen Fragen geworden sind, die eine so grundsätzliche Bearbeitung möglich machten, dass die Artikel veröffentlichbar wurden.
Aber was bitte ist denn Routine, wenn ich hier vor allem Methoden beschreibe, die ich für die Reflexion im Kontext meines Selbstbildes als reflektierender Praktiker nutze?
Routine ist dabei, dass es sich um Arbeitstechniken handelt, über die ich nicht groß nachdenken muss. Um Routinen handelt es sich, weil ich routiniert mit den eingesetzten Methodiken umgehen kann, da diese in hoher Frequenz von mir (nicht nur für Reflexion- sondern auch für Produktionsprozesse) genutzt werden.
Um eine zeitliche Komponente komme ich aber nicht herum, wenn Reflexionsroutinen effizient sein sollen.
Es geht nicht nur darum, dass genutzte Instrumente „nicht stören“, sondern auch darum, dass durch geplante Regelmäßigkeit möglichst viele Aspekte (des Gelingens, des Misslingens, der Planung für kommende Aktionen etc.) in den Blick des Reflexionsprozesses gelangen.
Entsprechend wird (mind.) einmal die Woche eine Unterrichtsstunde, eine Unterrichtssequenz, eine Lerngruppe oder ein Projekt (in Planung, in Durchführung oder kürzlich abgeschlossen) für (mind.) 60 Minuten reflektiert.
Außerdem wird nach jedem Unterrichtstag eine Notiz angefertigt, in der ich (mind.) ein Phänomen, das mir an diesem Tag im schulischen Kontext besonders aufgefallen ist, festhalte und knapp zu formulieren versuche, wo ich Gründe für das Phänomen sehe. Dabei kann es sich um sehr unterschiedliche Aspekte handeln.
Wenn sich aus diesen Routinen Fragestellungen ergeben, die näher betrachtet werden sollen, nehme ich die Fragestellungen zum Beispiel mit auf einen Spaziergang und versuche sie in Gedanken (oder in Form eines Audiofiles) reflexiv zu bearbeiten, wobei am Ende jeder Reflexion, ich bin ja reflektierender Praktiker, die Frage nach dem nächsten Schritt in der Praxis steht. Welche Aktionen ergeben sich aus der Reflexion? Am Ende des Reflexionsprozesses steht also meist die ToDo-Liste, in der die nächsten Handlungsschritte notiert werden.
Oder ich gehe mit der konkreten Fragestellung entweder handschriftlich um, sei es in Form eines Textes, einer Mindmap oder in sonstiger Form, oder nähere mich ihr tippender Weise, was den Vorteil hat, dass ich auch schon mal die Augen schließen, mich zurücklehnen und den Strom der Gedanken schnell und möglichst mittels Umgehung des inneren Zensors zu Papier bringen kann. Auch hier ist das Ziel das Finden der nächsten Handlungsschritte.
Für diese letzten Methoden gibt es keine festen Zeitraster. Die setze ich nach Notwendigkeit oder in zeitlichen Freiräumen ein.
Überhaupt, ich höre sie schon, die Frage nach der Zeit…
Sich als reflektierender Praktiker zu sehen ist ja schön und gut. Aber wann macht man das alles, angesichts von Verpflichtungen gut gefüllter Terminpläne?
Ganz ehrlich: Wenn ich meinem Terminkalender Glauben schenken würde, dann würde ich nie zu diesen Reflexionsprozessen kommen, denn der ist immer voll.
Interessanterweise geht mir aber nichts an Arbeit verloren, wenn ich zumindest die wöchentlichen Reflexionen als Termine festhalte, sodass an diese Stellen keine anderen Termine rücken können. Nichts bleibt dadurch liegen.
Darüber hinaus habe ich gelernt, dass ein guter Reflexionprozess auch die eigenen Arbeitsabläufe regelmäßig kritisch hinterfragt. Bei mir hat das immer wieder die Folge, dass ich überflüssige Dinge aus dem Arbeitsalltag heraus nehme und teilweise Routinen im Workflow entwickle, die mir Freiräume schaffen.
Wem das zu abstrakt ist, hier ein paar Beispiele:
- Ich nutze mittlerweile konsequent die Zwei-Minuten-Regel: Dinge, die sich in zwei Minuten erledigen lassen, werden sofort erledigt. Das führt zum Beispiel dazu, dass ich die meisten E-Mails genau ein einziges Mal öffne, lese und sofort beantworte. Früher habe ich E-Mails oft erst zur Kenntnis genommen, dann gesagt, dass ich das am nächsten Tag bearbeiten und mich jetzt nicht mehr drum kümmern will… Selbst wenn ich sie am nächsten Tag bearbeitet habe, brauchte ich da noch einmal Zeit, obwohl in der Zeit des Entscheidens, dass ich die Bearbeitung verschiebe, die Antwort schon verfasst hätte sein können. Das gilt auch, wenn ich zum Beispiel abends nochmal kurz online gehe und z. B. eine kurze Frage eines Elternteils oder eines Schülers vorliegt. Früher sagte ich mir, dass ich das nicht mehr abends beantworte, da ich Feierabend habe. Heute gibt es zwei Möglichkeiten: Ich will meine größtmögliche Ruhe, dann bleibe ich offline oder deaktivere den dienstlichen Mailaccount – z. B. wenn ich verreise –, oder aber ich habe den Account online, dann reagiere ich möglichst direkt, es sei denn es ist eine Antwort nötig, die mehr als zwei Minuten in Anspruch nimmt.
- Ich entlaste mein Gehirn durch konsequente Anwendung von ToDo-Listen, Kalendereinträgen und (ganz wichtig) automatisierten Erinnerungen. Dies konsequent zu tun führt dazu, dass ich nicht jedes Mal überlegen muss, ob nun ein Alarm eingeschaltet wurde oder nicht, wo diese und jene Funktion im verwendeten Programm zu finden ist etc. Dinge, die ich nicht gleich erledigen muss, kann ich so „vergessen“, weil ich darauf vertrauen kann, dass ich rechtzeitig erinnert werde. Dabei bin ich mit Erinnerungswiederholungen sehr großzügig und muss mich nicht ständig fragen, was denn an diesem Tag noch ansteht oder was ich im Laufe der Woche nicht vergessen werden darf. Das entlastet enorm.
- Darüber hinaus denke ich weniger in großen Projekten, sondern konsequent in „nächsten Schritten“, „nächsten Aktionen“ in einem Projekt, wobei es eben vorkommen kann, dass ich nichts tun kann, wenn ich auf die Zuarbeit eines Dritten warte, sodass ich in diesen Zeiten das Projekt einfach „vergesse“, mir aber eine Erinnerung schalte, bis wann die „Zuarbeit“ da sein soll und wann ich nochmal nachfrage. Auch das entlastet enorm und schafft Freiräume für zum Beispiel Reflexionsroutinen.
- Überhaupt: Die Beschäftigung mit dem GTD-Konzept (Getting-Things-Done) von David Allen hat mir viele Anregungen gegeben, wie Arbeitsprozesse organisiert sein können. Wer mehr dazu wissen will, kann ja mal recherchieren oder Allens Buch zum Thema lesen.
Mich als reflektierender Praktiker zu sehen, eigentlich kam ich darauf, weil im Referendariat mehrfach diese Formulierung fiel, dass Lehrer solche sein sollten, hat meine Lehrerrolle bis heute, so meine ich sagen zu können, deutlich geprägt und dynamisch gehalten.
Ich bin in den vergangenen Jahren ein anderer Lehrer geworden, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Berufseinstiegsphase wenig Routinen zulässt und diese erst entstehen müssen.
Dynamisch in der Rolle zu bleiben, bedeutet aber für mich, einmal gefundene Unterrichts-Routinen nicht unreflektiert ständig zu wiederholen, sondern diese zu verändern, zu ergänzen, um neue Methoden zu bereichern, aus ihnen Methoden heraus zu nehmen etc.
Diese Dynamik verlangt aber auch die Fähigkeit, ein wenig den Überblick über das zu behalten, was man leisten kann und was nicht.
Zur Reflexion gehört für mich auch die Reflexion über Leistungen, die ich bringe, die ich bringen will, bringen kann und die auch an Grenzen stoßen.
Kurz: Reflektiertes (begründetes, nicht reflexhaftes) Nein-Sagen ist auch Teil der Routinen, die es für mich als reflektierenden Praktiker zu beherrschen gilt.
Und was soll das ganze?
Nun, wenn mir Unterricht durch den Magen geht, wie am Anfang behauptet, dann geht es beim Einsatz von Reflexionsroutinen schlicht und ergreifend darum, mir den Appetit auf meinen Beruf zu bewahren, durch abwechslungsreiche Kost die Dynamik im Geschehen zu halten und durch die Lust am Kochen nicht nur neue Rezepte auszuprobieren, sondern diese auch überhaupt erst einmal zu finden oder zu kreieren.
Das Ziel dieser Reflexionen bin übrigens nicht ich selbst.
Das Ziel ist, den mir anvertrauten Schülerinnen und Schülern Lernwege zu eröffnen, auf denen sie ihre eigenen Potentiale entdecken, Kompetenzen entwickeln und sich selbstverständlich auch Wissen aneignen können.
Diese Verantwortung sollte schon regelmäßig – routiniert – die eine oder andere Minute oder Stunde der Reflexion eigener Praxis wert sein, auch wenn die Rahmenbedingungen dazu führen, dass ich allzu oft nur das selbst verordnete Minimum, das ich oben beschrieben habe, zu leisten in der Lage bin. Aber ohne Routinen würde dieses Minimum womöglich auch noch im Alltag untergehen. Da ich aber selbst dieses Minimum als Bereicherung erlebe, will ich nicht, dass der Sturm des Alltags dieses Floß als einen Ort des (kurzen) Innhaltens verschlingt – und pflege es entsprechend, um es nicht neu bauen zu müssen, wenn ich es habe untergehen lassen.
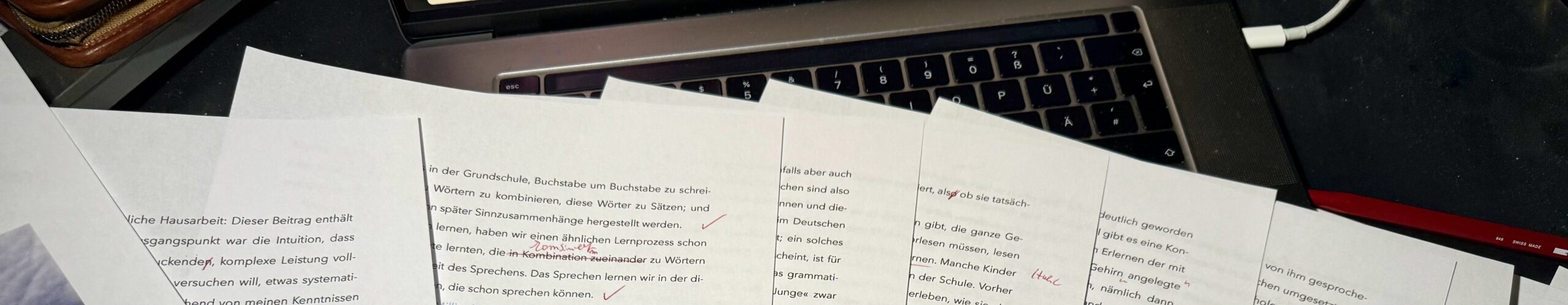
Eine Antwort auf “Unterricht geht durch den Magen oder: Mein Beitrag zur Blogparade „Reflektierende Praktiker (Lehrende und Co)“”